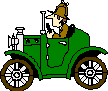|
|
|
|
|
Warum die Sitztheorie beim Wegzug einer Kapitalgesellschaft aus Deutschland gilt: |
|
|
|
A. Die nationale (deutsche) Sicht |
|
|
|
I. Vorgetragen wird die Schutzbedürftigkeit der Anteilseigner, der Gläubiger und der Arbeitnehmer. Des weiteren werden das Argument der Sachnähe und der wirksamen staatlichen Kontrolle vorgebracht. |
|
|
|
|
||
|
1. Schutz der Anteilseigner |
|
|
|
Befürchtet wird, dass die Anteilseigner, deren Gesellschaft ihren Sitz ins EU-Ausland verlegt, ihre Rechte nur noch unter Schwierigkeiten durchsetzen könnten. |
|
|
|
Dem ist zu entgegnen, dass die Gesellschaft ihren Sitz dann nur dann ins Ausland verlegen kann, wenn die entsprechende Grundlagenentscheidung mit mindestens der Mehrheit der Gesellschafter getroffen wurde. Diese Mehrheit ist weder schutzbedürftig noch schutzwürdig, weil sie der Verlagerung zugestimmt hat. Ansonsten schützte man die Mehrheit der Anteilseigner vor ihren eigenen Entscheidungen. Ein solcher Schutz ist im deutschen Kapitalgesellschaftsrecht aber nicht anerkannt. |
iQ: deswegen haben nach Art. 2437 des Codice Civile nur die ablehnenden Gesellschafter ein Recht auf Ausscheiden gegen Abfindung: „I soci dissenzienti dalle ... trasferimento della sede sociale all'estero ... hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle proprie azioni ...“ |
|
|
Es geht also nicht um den Schutz „der Anteilseigner“, sondern um den Schutz derjenigen (notwendig in der Minderheit befindlichen) Anteilseigner, die der Sitzverlegung nicht zugestimmt haben. Damit geht es um Minderheitenschutz. Minderheitenschutz wird aber grds. nicht dadurch gewährt, dass die Entscheidung der Mehrheit konterkariert wird, sondern durch die Entwicklung besonderer Schutzrechte der Minderheit. |
||
|
|
iQ: siehe dazu Art. 8 der VO Nr. 2157/2001 vom 8. 10. 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE), ABl. L 294/1 und das in Art. 2437 des Codice Civile festgelegte „diritto di recesso“. |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Befürchtet wird, dass die Gläubiger (ähnlich wie die überstimmten Anteilseigner) Schwierigkeiten bei der Rechtsdurchsetzung haben, wenn die Kapitalgesellschaft als Schuldner ins Ausland „wegtaucht“. |
|
|
|
Zum einen gibt es aber die VO Nr. 44/2001 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 22. Dezember 2000 (EuGVVO), die die EU-weite Durchsetzung von Ansprüchen erleichtert. Dieser gemeinschaftsrechtliche Mindeststandard spricht dagegen, zusätzliche und dabei beschränkende nationale Standards zu setzen, zumal es keinen Anspruch auf Identität der Rechtsordnungen gibt. Zum anderen wird bei einer Sitzverlagerung im Inland regelmäßig Vermögen verbleiben, in das die Gläubiger der Gesellschaft ggf. vollstrecken können. |
iQ: siehe auch das 11. Buch der ZPO, „Justizilelle Zusammenarbeit in der Europäischen Union“, das demnächst um §§ 1076 - 1078 erweitert werden wird, und zwar durch das EG-Prozesskostenhilfegesetz, durch das auch §§ 114 und 116 ZPO geändert werden sollen.
|
|
|
Schließlich gilt es stets auch das Übermaßverbot zu beachten. Wenn der deutsche Gesetzgeber die Gläubiger vor einem Entzug der Haftungsmasse durch Wegzug schützen will, ist dies zwar grds. anzuerkennen. Ein „Recht auf Verbleib oder Liquidation des Schuldners“ ist aber nicht erforderlich. Ausreichendes Mittel wäre - etwa nach dem Vorbild des § 21 Abs. 1 UmwG - eine Sicherheitsleistung durch die wegziehende Gesellschaft. Die Ausübung der Niederlassungsfreiheit durch Auflösung der Gesellschaft im Fall des Wegzugs zu behindern, bietet der Gläubigerschutz daher keine Grundlage. Ein Missbrauch des Wegzugsrechts muss in der Tat verhindert werden. Das bedeutet aber nicht, dass man deswegen allen, die wegziehen wollen, Knüppel zwischen die Beine werfen darf. Dass Letzteres auf Dauer auch nicht funktionieren kann, ist im Osten Deutschlands Ende der achziger Jahre bewiesen worden. |
iQ: siehe auch Art. 8 (insbesondere Abs. 7, 13, 15 u. 16) der VO Nr. 2157/2001 vom 8. 10. 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE), ABl. L 294/1 |
|
|
|
iQ: Führt man den Gedanken des Gläubigerschutzes als Recht auf Verbleib des Schuldners konsequent zu Ende, dürfte eine Kapitalgesellschaft auch nicht mehr von Rosenheim nach Lübeck ziehen, weil dem Gläubiger dadurch - z.B. was den Gerichtsstand und die Erreichbarkeit des Schuldners angeht - zusätzliche Schwierigkeiten entstehen können. |
|
|
|
|
|
|
3. Schutz der Arbeitnehmer |
|
|
|
Hier geht es darum, dass die Arbeitnehmer nicht nur als Gläubiger insbesondere des Arbeitslohns betroffen sind (dazu 2.), sondern auch hinsichtlich der betrieblichen Mitbestimmung. Befürchtet wird eine „Flucht aus der Mitbestimmung“. |
|
|
|
Ganz abgesehen davon, dass die Mitbestimmung weder vom theoretischen Prinzip mit seinen sozialistischen Reminiszenzen, noch von der praktischen Auswirkung her zu den unbedingt erhaltenswerten „Errungenschaften“ des deutschen Arbeitsrechts zählt, kann auch dieses Argument nicht überzeugen. |
|
|
|
|
iQ: „ein Solitär, keine Edelstein“, Junker, NJW 2004, 730, zur weltweiten Einzigartigkeit der deutschen Mitbestimmung. Junker, NJW 2004, 728, beleuchtet (u.a.), warum insbesondere die Gewerkschaften die Mitbestimmung als sakrosankt betrachten. So finanziert sich die (gewerkschaftsnahe) Hans-Böckler-Stiftung in beträchtlichem Umfang aus von den gewerkschaftlichen Arbeitnehmervertretern (§ 7 Abs. 2, Nrn. 1 - 3 a.E. MitbestG) - gemäß Beschlüssen des DGB-Bundesausschusses vom 7. 3. 1979 und 10. 10. 2000 - abgeführten Aufsichtsratstantiemen. Lt. entsprechendem Jahresbericht flossen der Stiftung in 2003 24,9 Mio. EUR von 39,5 Mio. EUR (Gesamthaushalt) i.F. derartiger „Fördererbeiträge“ zu. |
|
|
|
Zu den sozialistischen Reminiszenzen sei Hentsche, Das Mitbestimmungsgespräch (ISSN 0723-5976) 1973, 165, zitiert: „Dabei sollte Klarheit bestehen, daß die ... Mitbestimmung ... allein nicht ausreicht. Langfristig wird kein Weg vorbeiführen an der Zunahme staatlicher Planung, der Investitionskontrolle und der Überführung bestimmter Unternehmen in gesellschaftliches Eigentum.“ |
|
|
Zunächst ist zu berücksichtigen, dass die Mitbestimmung nach dem Mitbestimmungsgesetz erst ab einer bestimmten Betriebsgröße (mindestens 2.000 Arbeitnehmer) greift, sodass die Notwendigkeit ihrer Aufrechterhaltung keine allgemeine Anwendung der Sitztheorie auf alle Kapitalgesellschaften rechtfertigt. |
|
|
|
|
iQ: die meisten mittelständischen Kapitalgesellschaften sind mit diesem Argument nicht zu halten |
|
|
Soweit die Mitbestimmung nach dem Betriebsverfassungsgesetz gemeint ist, ist zu berücksichtigen, dass, solange der Betrieb trotz Verlegung des Unternehmenssitzes fortbesteht, der Betriebsrat bestehen bleibt. Des weiteren hat nicht jeder Betrieb einen Betriebsrat, sodass eine generelle Beschränkung der Niederlassungsfreiheit auch mit diesem Argument nicht gerechtfertigt werden kann. |
. |
|
|
|
iQ: selbst wenn man dieses Argument also grds. anerkennt, kann nur ein Teil der Kapitalgesellschaften gebunden werden; es ist aber angesichts des einheitlich geregelten Europäischen Betriebsrates (Rl. 94/45/EG; §§ 1 ff EBRG) zweifelhaft, ob die Niederlassungsfreiheit zum Zwecke weitergehender betrieblicher Mitbestimmung beschränkt werden darf. |
|
|
Selbst für die Betriebe, in denen eine Mitbestimmung zwingend vorgeschrieben ist bzw. in denen ein Betriebsrat besteht, kann die Auflösung der Kapitalgesellschaft bei Grenzübertritt aber nicht gerechtfertigt werden. Milderes Mittel ist hier die Sicherstellung der Mitbestimmung nach Sitzverlegung. Kann sich der Gesetzgeber zu einer entsprechenden Regelung nicht entschließen, geht dies nicht zu Lasten der Unternehmer, sondern zu Lasten derer, die durch die erweiternde Regelung berechtigt wären. |
|
|
|
|
|
|
|
4. Sachnähe |
|
|
|
Die Vorschriften des durch die Geschäfte hauptsächlich betroffenen Staates seien anwendbar. Dies sei sachgerecht. |
|
|
|
Es ist aber nicht erwiesen, dass eine wegziehende Gesellschaft hauptsächlich in ihrem Ursprungsstaat Geschäfte tätigt. Darüber hinaus basiert diese Sicht darauf, dass der Heimatstaat üblicherweise die besten, weil passendsten Vorschriften treffe. Auch dies überzeugt - unabhängig von der Wertschätzung des jeweiligen Gesetzgebers - als Grundlage für einen Ausschluss der Niederlassungsfreiheit deutscher Gesellschaften nicht, weil es sich um eine pauschale Behauptung handelt. |
|
|
|
|
|
|
|
5. wirksame staatliche Kontrolle |
|
|
|
Nur die Sitztheorie ermögliche es, zwingende nationale Vorschriften durchzusetzen. Nur so könne verhindert werden, dass schwächere ausländische Regelungen inländische gesellschaftsrechtliche Normen unterlaufen und in die inländische Sozialstruktur eingreifen. |
|
|
|
Dieses Argument ist mit dem Urteil des EuGH Centros in Bezug auf EU-ausländische „schwächere“ Normen erledigt. Außerdem führt die Anwendung der Sitztheorie dazu, dass der Gründungsstaat beim - trotz der aufgestellten Hürden erfolgenden - Wegzug eben jene Kontrolle verliert, weil die deutsche Kapitalgesellschaft untergeht, also nicht mehr kontrolliert werden kann, und die im Ausland neu gegründete ausländische Kapitalgesellschaft der deutschen Kontrolle entzogen ist. Wirksam kontrolliert werden also nur die Kapitalgesellschaften, die die Hürden des Wegzugs scheuen. Wer den Wegzug dagegen trotz der Schwierigkeiten nicht scheut, kann sich der Kontrolle entziehen. Damit ist das Argument nicht schlüssig. |
|
|
|
|
iQ: dem kann auch nicht mit der Unterscheidung zwischen Unternehmen und Unternehmensträger begegnet werden. Zwar kann der Unternehmensträger, die deutsche Kapitalgesellschaft, wendet man die Sitztheorie an, tatsächlich nicht wegziehen, weil er an der Grenze erlischt. Das Unternehmen selbst (zur Unterscheidung siehe hier) kann aber ins Ausland verlagert werden. Und damit wird der Gegenstand verlagert, auf den die wirksame Kontrolle abzielt. |
|
|
|
|
|
|
II. Generelle Betrachtung: |
|
|
|
1. Allgemein ist anzumerken, dass die Sitztheorie nicht geeignet ist, die Interessen der genannten Personengruppen effektiv zu schützen. Denn, wenn die Kapitalgesellschaft die Hürden ihrer Auflösung und Neugründung nimmt, also in Deutschland die Zelte abbricht, als juristische Person erlischt und im EU-Ausland nach dortigen Vorschriften neu gegründet wird, entfällt jeder Schutz. Effektiv wäre hier nur ein genereller Ausschluss der Niederlassungsfreiheit deutscher Unternehmen, d.h. ein Verbot des Wegzugs. Ein solches „Bleibe im Lande und nähre dich redlich“ lässt sich jedoch - als klare Verletzung des EG-Vertrages - nicht rechtfertigen. Indem die Sitztheorie aber, soweit sie sich „nur“ gegen den Wegzug richtet, genau dieses Ziel verfolgt, ist sie sophistisch und schon deswegen nicht überzeugend. |
|
|
|
|
|
|
|
2. Die Aufrechterhaltung der Sitztheorie trifft zwar auf Basis des Rspr. des EuGH scheinbar zu. Sie überzeugt aber nicht, weil die Ausübung der Niederlassungsfreiheit aus Artt. 43, 48 EG den Wegzug aus dem Gründungsstaat voraussetzt. Wenn die GmbH mit dem Wegzug ihre Rechtsfähigkeit verliert, wird diese Freiheit behindert, weil es - beispielsweise - einen Zwang zur Neugründung in Portugal, unter Beachtung der dort bestehenden Gründungsvorschriften, bedeutet. |
|
|
|
Insoweit überzeugt auch die - ansonsten treffende - Argumentation von Altmeppen, NJW 2004, 101, Fn. 43, es könne ja auch keinen Zweifel geben, dass der „Fahrer eines englischen Pkw auf deutschen Straßen rechts fahren muss“, nicht. Überträgt man nämlich die hM zur deutschen GmbH auf diesen Fall, löst sich ein Wagen an der Grenze in Luft auf, sodass man zum Fahren gar nicht mehr kommt. |
|
|
|
Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass es nicht nur die von Altmeppen launig erwähnte „Group of German Experts on Corporate Law“ (aaO., S. 104 mit Fn. 68) gibt. Für die europäische Rechtsentwicklung ist „The High Level Group of Company Law Experts“ (deutscher Vertreter: Klaus J. Hopt) mit ihrem „Report on a Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe“ vom 4. November 2002 zu beachten. Auf den Vorschlägen dieser Gruppe beruht u.a. der Aktionsplan der Europäischen Kommission zur Reform des Europäischen Gesellschaftsrechts (KOM(2003)284 endg.), der nicht weniger als 24 Maßnahmen vorsieht. Diese Gruppe hat zur Sitztheorie folgendes bemerkt (aao., S. 19): „There was almost unanimous agreement that for a Member State to adopt a version of the “real seat doctrine” which automatically denies recognition to a company which has its real seat in a country other than that of its incorporation was a disproportionate measure which can never be justified. |
|
|
|
Most respondents agreed that, in the case of a transfer of the real seat into a “real seat doctrine” state, there was a case for permitting the law of incorporation to be overridden to the extent necessary to respect requirements of the host state. The Group agrees with this view, but believes that any sanction inhibiting the freedom of movement should be subject to general EU principles, and it illustrates how they can be applied to various company law measures (capital maintenance; disclosure transparency and security of transactions; governance and company structure; employee participation). A transfer of the real seat out of a state of origin may be regarded as a means of escaping the law of origin, but any sanctions imposed by that state should be subject to the same general principles. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Die Argumente des EuGH aus der Entscheidung Daily Mail |
|
|
|
|
iQ: Die Argumentation des EuGH in Kurzform: |
|
|
|
1. Eine juristische Person kann ohne eine Rechtsordnung nicht existieren. Weil die juristischen Personen z.Zt. nur in den nationalen Rechtsordnungen geregelt sind, gilt der dortige Standard. |
|
|
|
2. Art. 48 EG-Vertrag lässt als Anknüpfungspunkt für die Niederlassungsfreiheit von Gesellschaften den tatsächlichen Sitz und den Verwaltungssitz zu. Auch das bisher erlassene Sekundärrecht trifft keine Regelung. Folglich bedeutet die Niederlassungsfreiheit nicht das Recht, als nationale Gesellschaft das Land zu verlassen. Insoweit greift die Niederlassungsfreiheit nicht, bevor eine gemeinschaftsrechtliche Regelung besteht. |
|
|
I. Der Ausgangspunkt |
|
|
|
EG 16: Die Niederlassungsfreiheit bedeutet nicht nicht nur Inländergleichbehandlung im Aufnahmemitgliedstaat. Sie verbietet auch dem Herkunftsstaat, die Niederlassung einer nach seinem Recht gegründeten Gesellschaft i.S.d. Art 48 EG-Vertrag in einem anderen Mitgliedstaat zu behindern, ist also Beschränkungsverbot, soweit es um Standortwahl und Wegzug geht. Sonst würden Artt. 43 ff. EG-Vertrag leer laufen. |
|
|
|
EG 18: Das britische Recht beschränkt die Niederlassungsfreiheit nicht. Sie verhindert auch nicht die Übertragung des Kapitals einer Gesellschaft britischen Rechts auf eine in einem anderen Mitgliedstaat neu gegründete Gesellschaft. Eine Hürde besteht „nur“, wenn die Gesellschaft unter Beibehaltung ihrer Eigenschaft als Gesellschaft britischen Rechts den Sitz ihrer Geschäftsleitung in einen anderen Mitgliedstaat verlegen will. |
|
|
|
|
|
|
|
II. Die Begründung |
|
|
|
EG 19: Beim gegenwärtigen Stand des Gemeinschaftsrechts werden Gesellschaften aufgrund einer nationalen Rechtsordnung gegründet. Jenseits der jeweiligen nationalen Rechtsordnung, die ihre Gründung und ihre Existenz regelt, haben sie keine Realität. |
|
|
|
|
iQ: Gemeint ist, dass das Bestehen einer juristischen Person - im Gegensatz zur natürlichen Person, die als solche unabhängig von der Rechtsordnung existiert - eine (z.Zt. nationale) Rechtsordnung voraussetzt. |
|
|
EG 20: Insoweit bestehen erhebliche Unterschiede im Recht der Mitgliedstaaten. In einigen Staaten muss der tatsächliche Verwaltungssitz im Inland liegen, sodass die Verlegung der Geschäftsleitung zur Liquidierung der Gesellschaft führt. Insbesondere auf dem Gebiete des Steuerrechts sind die rechtlichen Folgen der Verlegung in jedem Mitgliedstaat anders. |
|
|
|
|
iQ: Im Januar 1985 wurde dem Rat durch die Komission der Vorschlag für eine Rl. zur grenzüberschreitenden Fusion von Aktiengesellschaften vorgelegt. Mit der Fusionsbesteuerungs-Rl. 90/434/EWG werden zumindest die steuerlichen Auswirkungen grenzüberschreitender Fusionen, d.h. insbesondere die Aufdeckung stiller Reserven, siehe Art. 4 der Rl., vermieden. Insoweit wurde die Rl. von Deutschland bewusst nicht (im UmwStG) umgesetzt. Dort (§ 23 UmwStG) ist nur die grenzüberschreitende Einbringung geregelt. |
|
|
... |
... |
|
|
EG 21: Der EG-Vertrag berücksichtigt diese Unterschiede im nationalen Recht. Art. 48 EG-Vertrag unterscheidet nicht zwischen satzungsmäßigem und tatsächlichen Sitz einer Gesellschaft. Art. 293 EG-Vertrag sieht den Abschluss von Übereinkommen unter den Mitgliedstaaten vor. „Bis heute [27. September 1988] ist ein derartiges Übereinkommen nicht in Kraft getreten.“ |
|
|
|
EG 22: Keine der Richtlinien zur Koordinierung des Gesellschaftsrechts gem. Art. 44 Abs. 2 Buchstabe g EG-Vertrag trifft insoweit Regelungen. |
|
|
|
EG 23: Folglich sieht der EG-Vertrag die Unterschiede in den nationalen Rechtsordnungen hinsichtlich der Anknüpfung an den satzungsmäßigen oder tatsächlichen Sitz einer Gesellschaft nationalen Rechts als durch die Niederlassungsfreiheit nicht geregelt an. Es bedarf einer eigenen Rechtssetzung; „eine solche wurde jedoch noch nicht gefunden.“ |
|
|
|
EG 24: Somit gewähren die Artt. 43 und 48 EG-Vertrag den Gesellschaften nationalen Rechts beim gegenwärtigen Stand des Gemeinschaftsrechts kein Recht, ihren tatsächlichen Sitz als Gesellschaften des Gründungsstaates in einen anderen Mitgliedstaat zu verlegen. |
|
|
|
|
|
|
|
III. Stellungnahme: |
|
|
|
Zunächst ist mit Wymeersch, ECGI Law Working Paper Nr. 08/2003, S. 19, festzustellen, dass die Entscheidung Daily Mail keine Grundlage für die Aufrechterhaltung der Sitztheorie bildet. Wesentlicher Punkt der Entscheidung Daily Mail war nämlich nicht die Sitzverlegung. Die Daily Mail and General Trust plc. wollte - als britische Gesellschaft - ausschließlich dem für sie vorteilhaften niederländischen Steuerrecht unterstellt werden. Es ging also darum, dass eine in einem Gründungsdoktrin-Staat gegründete Gesellschaft sich - entgegen der Gründungsdoktrin, nach der das Recht des Gründungsstaates auf die Gesellschaft bis zu deren Beendigung anwendbar bleibt - ein anderes Steuerrechtssystem aussuchen wollte. Es ging also nicht um die Sitz-, sondern um die Gründungstheorie. |
iQ: “This is the paradox of Daily Mail: the company did not – and could not – strive at changing its legal regime, but only wanted to become subject to the Dutch tax regime by establishing its centre or administration in the Netherlands.“ |
|
|
Außerdem lässt sich die mit der Sitztheorie verbundene Unmöglichkeit des Wegzugs einer Gesellschaft schwerlich mit Artt. 43; 48 EG-Vertrag vereinbaren. Wenn die Gesellschaft aufgelöst und neu gegründet werden muss, damit sie sich in einem anderen Mitgliedstaat niederlassen kann, kann die Niederlassungsfreiheit nicht so ausgeübt werden wie Art. 48 EG-Vertrag dies vorsieht. Auch wenn der EuGH ausführt, das nationale Recht erlaube die Übertragung des gesamten Vermögens der als solche an die Heimat gebundenen Gesellschaft auf die im Ziel-Mitgliedstaat zu gründende neue Gesellschaft, wird dies deutlich: Dass der Grenzübertritt hinsichtlich des Unternehmensgegenstandes auf Umwegen erreicht werden kann, ist bei weitem kein Argument dafür, dass der direkte Weg für das Unternehmen selbst versperrt werden darf. |
iQ: um beim Beispiel des in Deutschland gefälligst rechts fahrenden Engländers zu bleiben: wer seinen Wagen vor der Grenze auseinander nehmen und ihn hinter der Grenze wieder zusammenbauen muss, wird sich die Reise im Zweifel sparen |
|
|
Schließlich ist die Ausgestaltung des Art. 48 EG-Vertrag nicht, wie der EuGH das ausführt, als Einladung zur Anerkennung nationaler Hürden gegen den Wegzug zu verstehen. Seine Fassung geht auf die Überlegung zurück, dass die nationalen Unterschiede hinsichtlich Sitztheorie etc. keinen Einfluss auf die Gleichstellung der Gesellschaften i.S.d. Kapitel 3 der Grundfreiheiten haben soll. Ausgerechnet mit dieser auf die umfassende Gewährung der Freiheit zielenden Vorschrift die Zulässigkeit nationaler Beschränkungen auf dem Gebiet des Gesellschaftsrechts zu rechtfertigen, d.h. eine Beschränkung der Niederlassungsfreiheit, stellt die Regelung auf den Kopf. Allenfalls wichtige Gründe des Gemeinwohls können einen solche Beschränkung rechtfertigen. |
iQ: die einmal wirksam gegründete Gesellschaft wird der natürlichen Person i.S.d. Art. 43 EG-Vertrag gleichgestellt - erst aus Art. 293, Spiegelstrich 3 EG-Vertrag ist ersichtlich, dass dies nicht zwingend auch für den Wegzug gilt. |
|
|
|
iQ: siehe auch die - allerdings auf natürliche Personen bezogenen - Erwägungen des EuGH in der Entscheidung Rs. C-9/02, Hughes de Lasteyrie du Saillant, vom 11. 3. 2004: |
|
|
|
44: „[D]ie Mitgliedstaaten müssen die ihnen verbliebenen Befugnisse ... unter Wahrung des Gemeinschaftsrechts ausüben (Urteile vom 14. Februar 1995 in der Rechtssache C-279/93, Schumacker, Slg. 1995, I-225, Randnr.21, ICI, Randnr. 19, und vom 21. November 2002 in der Rechtssache C-436/00, X und Y, Slg. 2002, I-10829, Randnr. 32).“ |
|
|
|
49: „Zweitens ist daran zu erinnern, dass eine Maßnahme, die geeignet ist, die ... Niederlassungsfreiheit zu beschränken, nur zulässig sein kann, wenn mit ihr ein berechtigtes und mit dem EG-Vertrag zu vereinbarendes Ziel verfolgt wird und sie durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt ist. In einem solchen Fall muss allerdings ihre Anwendung zur Erreichung des damit verfolgten Zieles geeignet sein und darf nicht über das hinausgehen, was hierzu erforderlich ist (Urteile Futura Participations und Singer, Randnr.26 und dort zitierte Rechtsprechung, sowie X und Y, Randnr.49).“ |
|
|
|
|
|
|
Von Niederlassungsfreiheit i.S.d. Artt. 43; 48 EG kann also nur und erst gesprochen werden, wenn auch der Wegzug einer Gesellschaft als solcher möglich ist. |
|
|
|
Nationale Beschränkungen, die die Ausübung der durch den Vertrag garantierten grundlegenden Freiheiten weniger attraktiv machen können, darf es - wie der EuGH in der Entscheidung Gebhard (NJW 1996, 579) ausgeführt hat - nur geben, wenn diese Maßnahmen vier Voraussetzungen erfüllen (EG 37): |
|
|
|
- sie dürfen nicht in diskriminierender Weise angewendet werden und |
||
|
- sie müssen aus zwingenden Gründen des Allgemeininteresses gerechtfertigt sein und |
||
|
- sie müssen geeignet sein, die Verwirklichung des mit ihnen verfolgten Zieles zu gewährleisten und |
||
|
- sie dürfen nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung dieses Zieles erforderlich ist. |
||
|
An diesen hohen Hürden muss auch die Beschränkung des Wegzugs gemessen werden, und nicht an den spätestens von Mai 2004 an nahezu unüberschaubaren nationalen Eigenheiten. |
|
|
|
|
iQ: selbst wenn man dem nicht folgt, ist die Diskriminierung inländischer Kapitalgesellschaften durchaus nicht so ohne weiteres zulässig wie häufig angenommen. Denn das Europarecht ist nicht aller Weisheit Ende - und so stellt sich die Frage, ob die Bindung deutscher Gesellschaften (grundrechtsfähig nach Art. 19 Abs. 4 GG) an den deutschen Boden gem. Art. 3 GG (Gleichbehandlungsgebot) zulässig ist. Immerhin wird die ausländische Gesellschaft in Hinblick auf den Wegzug besser behandelt, ohne dass dafür (s.o.) plausible Gründe ins Feld geführt werden können. |
|
|
|
Außerdem ist die Sicht, der Staat könne die juristische Person nach Belieben definieren, und dann eben auch die Existenz der Gesellschaft willkürlich regeln, nicht zeitgemäß. Sie ist Reststück einer vom Staat ausgehenden Theorie auch der privatrechtlichen juristischen Person als eines durch den Staat hervor-, d.h. ins Leben gerufenen Gebildes. |
|
|
|
Obwohl die juristische Person, wie schon ihre Bezeichnung sagt, eines rechtlichen Rahmens bedarf, ist sie aber nicht Ergebnis staatlichen Handelns, sondern Ergebnis des Handelns - einzelner oder mehrerer - Privatpersonen. Letztere werden dabei als Grundrechtsträger und in Verwirklichung ihrer verfassungsmäßigen Rechte (u.a. Berufs-, Eigentums- und Handlungsfreiheit) aktiv. Die Rechtspersönlichkeit der juristischen Person des Privatrechts leitet sich folglich von den Gründern her. Und damit ist die Versagung grenzüberschreitender Betätigung nicht bloße Definition, nicht bloße Versagung weitergehender staatlicher Anerkennung, sondern ein Eingriff in eine Grundrechtsposition. |
|
|
|
CLM |
|